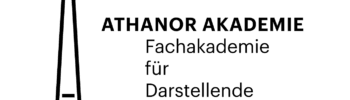Athen, um 410 v.Chr. Zwanzig Jahre dauert der Krieg zwischen Athen und seinen Nachbarstädten nun schon und die zurückgebliebenen Frauen haben den ewigen Bruderzwist gründlich satt – aber was tun? Lysistrata ergreift die Initiative. Sie ruft alle Frauen aller Krieg führenden Parteien zusammen und trägt ihnen einen Plan vor, wie man die kriegssüchtigen Männer kurieren könne: Kein Sex- bis Frieden herrscht!
Nach Schwur und Schlachtruf besetzen die Frauen die Akropolis. Die Staatskasse wird unter ihre Kontrolle gebracht und sie wehren Beschimpfungen und Angriffe der Männer erfolgreich ab. Doch mit der Zeit droht die eigene Lust den Widerstand der Frauen zu zersetzen. Aber zusammen bleiben sie standhaft, denn sie kämpfen hier nicht nur gegen den Krieg, sondern auch um die eigene Anerkennung und Gleichberechtigung. Schließlich legen die Männer ihren Krieg bei – körperlich entmachtet, aber mit unwiderlegbaren Argumenten für den Frieden konfrontiert: Sex befriedigt mehr als Krieg und ohne Frauen gibt es gar keine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Aristophanes` vor über 2000 Jahren geschriebenes Stück ist leider immer noch hoch aktuell. Neben dem immerwährenden Thema des Krieges sind auch die vielen emanzipatorischen Anspielungen auf die heutigen Beziehungen zwischen Frauen und Männern und die Verhältnisse in der Gesellschaft durchaus übertragbar: Wer hat das Sagen? Wer versorgt die Kinder? Wer verdient das Geld? Wer engagiert sich in der Politik? Wieso herrscht immer noch keine Gleichstellung? Warum gibt es immer noch soviel Gewalt, auch in Beziehungen?
Benedikt Buchecker greift mit seiner Inszenierung diese Gesellschaftskritik auf und erweitert sie geschickt. Lysistrata wird bei ihm zum Vexierspiel zwischen dem Damals und den, scheinbar emanzipierten, Gegebenheiten heute. Denn auch im Hier und Jetzt müssen wir uns weiterhin unbequeme Fragen stellen, zu den Rollen, die Frauen in unserer Zeit einnehmen (dürfen) und ob, auch angesichts der realen Gewalt, der sich Frauen immer noch ausgesetzt sehen, der Kampf der Geschlechter wirklich schon ausgetragen ist, oder es eine weitere Runde braucht, um ihn und unser selbstzerstörerisches Streben nach Macht ein für allemal zu begraben
Nach Schwur und Schlachtruf besetzen die Frauen die Akropolis. Die Staatskasse wird unter ihre Kontrolle gebracht und sie wehren Beschimpfungen und Angriffe der Männer erfolgreich ab. Doch mit der Zeit droht die eigene Lust den Widerstand der Frauen zu zersetzen. Aber zusammen bleiben sie standhaft, denn sie kämpfen hier nicht nur gegen den Krieg, sondern auch um die eigene Anerkennung und Gleichberechtigung. Schließlich legen die Männer ihren Krieg bei – körperlich entmachtet, aber mit unwiderlegbaren Argumenten für den Frieden konfrontiert: Sex befriedigt mehr als Krieg und ohne Frauen gibt es gar keine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Aristophanes` vor über 2000 Jahren geschriebenes Stück ist leider immer noch hoch aktuell. Neben dem immerwährenden Thema des Krieges sind auch die vielen emanzipatorischen Anspielungen auf die heutigen Beziehungen zwischen Frauen und Männern und die Verhältnisse in der Gesellschaft durchaus übertragbar: Wer hat das Sagen? Wer versorgt die Kinder? Wer verdient das Geld? Wer engagiert sich in der Politik? Wieso herrscht immer noch keine Gleichstellung? Warum gibt es immer noch soviel Gewalt, auch in Beziehungen?
Benedikt Buchecker greift mit seiner Inszenierung diese Gesellschaftskritik auf und erweitert sie geschickt. Lysistrata wird bei ihm zum Vexierspiel zwischen dem Damals und den, scheinbar emanzipierten, Gegebenheiten heute. Denn auch im Hier und Jetzt müssen wir uns weiterhin unbequeme Fragen stellen, zu den Rollen, die Frauen in unserer Zeit einnehmen (dürfen) und ob, auch angesichts der realen Gewalt, der sich Frauen immer noch ausgesetzt sehen, der Kampf der Geschlechter wirklich schon ausgetragen ist, oder es eine weitere Runde braucht, um ihn und unser selbstzerstörerisches Streben nach Macht ein für allemal zu begraben

Athen, um 410 v.Chr. Zwanzig Jahre dauert der Krieg zwischen Athen und seinen Nachbarstädten nun schon und die zurückgebliebenen Frauen haben den ewigen Bruderzwist gründlich satt – aber was tun? Lysistrata ergreift die Initiative. Sie ruft alle Frauen aller Krieg führenden Parteien zusammen und trägt ihnen einen Plan vor, wie man die kriegssüchtigen Männer kurieren könne: Kein Sex- bis Frieden herrscht!
Nach Schwur und Schlachtruf besetzen die Frauen die Akropolis. Die Staatskasse wird unter ihre Kontrolle gebracht und sie wehren Beschimpfungen und Angriffe der Männer erfolgreich ab. Doch mit der Zeit droht die eigene Lust den Widerstand der Frauen zu zersetzen. Aber zusammen bleiben sie standhaft, denn sie kämpfen hier nicht nur gegen den Krieg, sondern auch um die eigene Anerkennung und Gleichberechtigung. Schließlich legen die Männer ihren Krieg bei – körperlich entmachtet, aber mit unwiderlegbaren Argumenten für den Frieden konfrontiert: Sex befriedigt mehr als Krieg und ohne Frauen gibt es gar keine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Aristophanes` vor über 2000 Jahren geschriebenes Stück ist leider immer noch hoch aktuell. Neben dem immerwährenden Thema des Krieges sind auch die vielen emanzipatorischen Anspielungen auf die heutigen Beziehungen zwischen Frauen und Männern und die Verhältnisse in der Gesellschaft durchaus übertragbar: Wer hat das Sagen? Wer versorgt die Kinder? Wer verdient das Geld? Wer engagiert sich in der Politik? Wieso herrscht immer noch keine Gleichstellung? Warum gibt es immer noch soviel Gewalt, auch in Beziehungen?
Benedikt Buchecker greift mit seiner Inszenierung diese Gesellschaftskritik auf und erweitert sie geschickt. Lysistrata wird bei ihm zum Vexierspiel zwischen dem Damals und den, scheinbar emanzipierten, Gegebenheiten heute. Denn auch im Hier und Jetzt müssen wir uns weiterhin unbequeme Fragen stellen, zu den Rollen, die Frauen in unserer Zeit einnehmen (dürfen) und ob, auch angesichts der realen Gewalt, der sich Frauen immer noch ausgesetzt sehen, der Kampf der Geschlechter wirklich schon ausgetragen ist, oder es eine weitere Runde braucht, um ihn und unser selbstzerstörerisches Streben nach Macht ein für allemal zu begraben
Nach Schwur und Schlachtruf besetzen die Frauen die Akropolis. Die Staatskasse wird unter ihre Kontrolle gebracht und sie wehren Beschimpfungen und Angriffe der Männer erfolgreich ab. Doch mit der Zeit droht die eigene Lust den Widerstand der Frauen zu zersetzen. Aber zusammen bleiben sie standhaft, denn sie kämpfen hier nicht nur gegen den Krieg, sondern auch um die eigene Anerkennung und Gleichberechtigung. Schließlich legen die Männer ihren Krieg bei – körperlich entmachtet, aber mit unwiderlegbaren Argumenten für den Frieden konfrontiert: Sex befriedigt mehr als Krieg und ohne Frauen gibt es gar keine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Aristophanes` vor über 2000 Jahren geschriebenes Stück ist leider immer noch hoch aktuell. Neben dem immerwährenden Thema des Krieges sind auch die vielen emanzipatorischen Anspielungen auf die heutigen Beziehungen zwischen Frauen und Männern und die Verhältnisse in der Gesellschaft durchaus übertragbar: Wer hat das Sagen? Wer versorgt die Kinder? Wer verdient das Geld? Wer engagiert sich in der Politik? Wieso herrscht immer noch keine Gleichstellung? Warum gibt es immer noch soviel Gewalt, auch in Beziehungen?
Benedikt Buchecker greift mit seiner Inszenierung diese Gesellschaftskritik auf und erweitert sie geschickt. Lysistrata wird bei ihm zum Vexierspiel zwischen dem Damals und den, scheinbar emanzipierten, Gegebenheiten heute. Denn auch im Hier und Jetzt müssen wir uns weiterhin unbequeme Fragen stellen, zu den Rollen, die Frauen in unserer Zeit einnehmen (dürfen) und ob, auch angesichts der realen Gewalt, der sich Frauen immer noch ausgesetzt sehen, der Kampf der Geschlechter wirklich schon ausgetragen ist, oder es eine weitere Runde braucht, um ihn und unser selbstzerstörerisches Streben nach Macht ein für allemal zu begraben

Athen, um 410 v.Chr. Zwanzig Jahre dauert der Krieg zwischen Athen und seinen Nachbarstädten nun schon und die zurückgebliebenen Frauen haben den ewigen Bruderzwist gründlich satt – aber was tun? Lysistrata ergreift die Initiative. Sie ruft alle Frauen aller Krieg führenden Parteien zusammen und trägt ihnen einen Plan vor, wie man die kriegssüchtigen Männer kurieren könne: Kein Sex- bis Frieden herrscht!
Nach Schwur und Schlachtruf besetzen die Frauen die Akropolis. Die Staatskasse wird unter ihre Kontrolle gebracht und sie wehren Beschimpfungen und Angriffe der Männer erfolgreich ab. Doch mit der Zeit droht die eigene Lust den Widerstand der Frauen zu zersetzen. Aber zusammen bleiben sie standhaft, denn sie kämpfen hier nicht nur gegen den Krieg, sondern auch um die eigene Anerkennung und Gleichberechtigung. Schließlich legen die Männer ihren Krieg bei – körperlich entmachtet, aber mit unwiderlegbaren Argumenten für den Frieden konfrontiert: Sex befriedigt mehr als Krieg und ohne Frauen gibt es gar keine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Aristophanes` vor über 2000 Jahren geschriebenes Stück ist leider immer noch hoch aktuell. Neben dem immerwährenden Thema des Krieges sind auch die vielen emanzipatorischen Anspielungen auf die heutigen Beziehungen zwischen Frauen und Männern und die Verhältnisse in der Gesellschaft durchaus übertragbar: Wer hat das Sagen? Wer versorgt die Kinder? Wer verdient das Geld? Wer engagiert sich in der Politik? Wieso herrscht immer noch keine Gleichstellung? Warum gibt es immer noch soviel Gewalt, auch in Beziehungen?
Benedikt Buchecker greift mit seiner Inszenierung diese Gesellschaftskritik auf und erweitert sie geschickt. Lysistrata wird bei ihm zum Vexierspiel zwischen dem Damals und den, scheinbar emanzipierten, Gegebenheiten heute. Denn auch im Hier und Jetzt müssen wir uns weiterhin unbequeme Fragen stellen, zu den Rollen, die Frauen in unserer Zeit einnehmen (dürfen) und ob, auch angesichts der realen Gewalt, der sich Frauen immer noch ausgesetzt sehen, der Kampf der Geschlechter wirklich schon ausgetragen ist, oder es eine weitere Runde braucht, um ihn und unser selbstzerstörerisches Streben nach Macht ein für allemal zu begraben
Nach Schwur und Schlachtruf besetzen die Frauen die Akropolis. Die Staatskasse wird unter ihre Kontrolle gebracht und sie wehren Beschimpfungen und Angriffe der Männer erfolgreich ab. Doch mit der Zeit droht die eigene Lust den Widerstand der Frauen zu zersetzen. Aber zusammen bleiben sie standhaft, denn sie kämpfen hier nicht nur gegen den Krieg, sondern auch um die eigene Anerkennung und Gleichberechtigung. Schließlich legen die Männer ihren Krieg bei – körperlich entmachtet, aber mit unwiderlegbaren Argumenten für den Frieden konfrontiert: Sex befriedigt mehr als Krieg und ohne Frauen gibt es gar keine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Aristophanes` vor über 2000 Jahren geschriebenes Stück ist leider immer noch hoch aktuell. Neben dem immerwährenden Thema des Krieges sind auch die vielen emanzipatorischen Anspielungen auf die heutigen Beziehungen zwischen Frauen und Männern und die Verhältnisse in der Gesellschaft durchaus übertragbar: Wer hat das Sagen? Wer versorgt die Kinder? Wer verdient das Geld? Wer engagiert sich in der Politik? Wieso herrscht immer noch keine Gleichstellung? Warum gibt es immer noch soviel Gewalt, auch in Beziehungen?
Benedikt Buchecker greift mit seiner Inszenierung diese Gesellschaftskritik auf und erweitert sie geschickt. Lysistrata wird bei ihm zum Vexierspiel zwischen dem Damals und den, scheinbar emanzipierten, Gegebenheiten heute. Denn auch im Hier und Jetzt müssen wir uns weiterhin unbequeme Fragen stellen, zu den Rollen, die Frauen in unserer Zeit einnehmen (dürfen) und ob, auch angesichts der realen Gewalt, der sich Frauen immer noch ausgesetzt sehen, der Kampf der Geschlechter wirklich schon ausgetragen ist, oder es eine weitere Runde braucht, um ihn und unser selbstzerstörerisches Streben nach Macht ein für allemal zu begraben